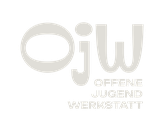Laufende Projekte und Experimente
Das Joghurtbecher-Experiment
OJW-Experiment 1 für den Chemie-Unterricht:
Begreifbare Molekülbindungskräfte
Fragestellung: Wie können wir primäre und sekundäre Kräfte zwischen Molekülen, in diesen Fall
zwischen Makromolekülen bei Kunststoffen, veranschaulichen? Wie können wir sie mit den
Händen begreifen?
Experiment: Man nehme einen leeren Milch- oder Joghurtbecher und zerdrücke ihn. Er bricht. Er
bricht aber nur in Längsrichtung! Warum? Versucht man ihn quer dazu zu brechen,
dann kann man 100 oder 1000 mal hin und her biegen. Er bricht nicht. Warum?
Erklärung: Beim Herstellen des Bechers werden infolge Scherkräfte im Tiefzieh-Werkzeug (oder in
einem Spritzgießwerkzeug) die Makromoleküle stark in die Längsrichtung
orientiert und beim Abkühlen in dieser Lage eingefroren. Es liegt also
gestecktes Molekül neben gestrecktem Molekül. Dazwischen wirken die sogenannten
sekundären Bindungskräfte (früher Nebenvalenz-Bindekräfte). Und die sind
deutlich schwächer, ca. um Faktor 30, als die primären Bindungskräfte (früher
Hauptvalenz-Bindekräfte) in der Molekülkette, also zwischen den Atomen, die das Molekül bilden. Und die sind viel stärker, sodass der Kunststoff beim Biegen quer zur Längsrichtung nicht
bricht.
Anwendung: Bei Filmscharnieren in Dosen mit angespritztem Deckel oder bei zweiteiligen Überraschungseier-Gefäßen nutzt man das aus.
Bild unten, links: Joghurt- oder Milchbecher, tiefgezogen aus Polystyrol (PS)
Bild unten, mitte: Zerdrückt man den Becher, reißt er nur in Längsrichtung auf; belastet man ihn
quer dazu durch Biegen, bricht er nicht!
Bild unten, rechts: wird beim nächsten Experiment erklärt!
OJW-Experiment 2 für den Physik-Unterricht:
Entropie oder der 2. Hauptsatz der Thermodynamik
Fragestellung: Wie reagieren eingefrorenen Molekülorientierungen in einem Joghurt- Becher, wenn
wir ihn bei erhöhter Temperatur in den Ofen stellen?
Experiment: Man nehme einen leeren Milch- oder Joghurtbecher aus Polystyrol (PS) und stelle ihn
in einen ca. 130 °C heißen (Back-)Ofen. Was passiert nach ca. 5-10 Minuten? Erklärung: Beim Herstellen des Bechers werden infolge Scherkräfte im Tiefzieh-Werkzeug (oder in einem
Spritzgießwerkzeug) die Makromoleküle stark in die Längsrichtung orientiert und beim Abkühlen in dieser Lage eingefroren. Es liegt also gestrecktes Molekül neben gestrecktem Molekül. In der Wärmelehre gilt die Regel (2. Hauptsatz der Thermodynamik): alles strebt dem Zustand größter Unordnung (Entropiemaximum) zu. Für die orientierten Makromoleküle in unserem PS-Becher war somit Energie zum Orientieren der Moleküle notwendig. Wenn wir den Molekülen nun gestatten,
diesen entropisch ungünstigen (also geordneten, orientireten) Zustand wieder zu
verlassen, dann müssten sie sich an ihre entropisch günstigste (also ungeordnete) Form zurückerinnern. Dies ist bei Makromolekülen die Knäuelform. Sie ist entropisch am günstigsten, weil am ungeordnetsten. Es muss also eine Rückstellkraft innerhalb der orientierten Makromoleküle im Becher bestehen, sobald wir den Einfrierzustand auflösen. Wie geschieht das? Indem wir den
Jughurtbecher in den Ofen stellen. Die Moleküle knäueln sich beim PS bei ca. 130 °C zusammen, der Becher erinnert sich (Memeory-Effekt) an seine Ausgangsform, die Folie, er schrumpft zurück. Das Bild Teil rechts zeigt die kreisrunde geschrumpfte Platte. Bei Polypropylen (PP) geschieht das Gleiche,
nur brauchen wir da 165°C.
Anwendung: Schrumpfschläuche zum Isolieren und schützen von elektrischen Verbindungen;
Bild unten, links: Joghurt- oder Milchbecher, tiefgezogen aus Polystyrol (PS)
Bild unten, mitte: Siehe dazu OJW-Experiment 1
Bild unten, rechts: Joghurtbecher-Moleküle erinnern sich an Ihre geknäuelte Ausgangssituation (Memory-Effekt) und schrumpfen zur ebenen Folie zurück
OJW Experiment 3 für den Physikunterricht:
Recycling bei Joghurtbechern
Fragestellung: Ist bei der Herstellung von Joghurtbechern das Einmischen von Recyclingware in den Kunststoff möglich?
Antwort: Technisch ist das möglich. Doch aus hygienischen Gründen ist ein Untermischen von Recyclingware (Sekundärkunststoff) bei Verpackungen für Lebensmittel nicht erlaubt. Die
Schicht des Bechers, die mit z.B. dem Joghurt in Berührung kommt, muss Originalware (Primärkunststoff, oder Neuware) sein.
Experiment bei Müllermilch Bechern: Zerdrückt man nun einen Müllermilch-Becher, siehe Bild unten, mitte, (ich muss hier für Müllermilch Werbung machen, weil andere Becher-Hersteller die gleich im Folgenden beschriebene Verfahrenstechnik meines Wissens nicht anwenden), dann sieht man
bei genauem Hinsehen im Querschnitt der etwa 0,4 mm dicken Becherwand 3 Schichten. die beiden äußeren weißen Schichten sind Neuware und schließen eine graue mittlere Schicht ein. Diese stammt von alten recycelten Joghurt-Bechern. Mittels Co-Extrusion kann man Folien schichtweise extrudieren (bis zu 8 und mehr Schichten), was die Firma hier zur Einhaltung der Hygienevorschriften
umsetzt. Das ist eine lobenswerte Technik zur nachhaltigen Verpackung. Anwendungen: Neben Milchbechern verwendet man coextrudierte Folien z.B. zur Verringerung von Austreten von Gasen durch Folien oder Benzin-Tanks, indem man besonders dichte Kunststoffe als Zwischenlagen einarbeitet. Auch Haftvermittler-Folien werden eingesetzt, um die Lagen gut miteinander
zu verbinden. Farbeffektfolien werden per Coextrusion unter eine transparente kratzfeste Oberflächen-Folie zum Schutz gegen Verschleiß gelegt.
Bild unten, links: Joghurt- oder Milchbecher, tiefgezogen aus Polystyrol (PS)
Bild unten, mitte: Zerdrückt man den Becher, dann sieht man an der Original-Bruchfläche 3 Schichten; leider im Bild hier nicht zu sehen.
Bild unten, rechts: wird beim Experiment 2 erklärt!

Experimente vorgestellt von Peter Eyerer
Forschungsprojekt Fledermausnisthilfen im Steinbruch der OJW

Vier Nistkästen für Fledermäuse bereichern seit vergangenem Montag das Steinbruchgelände der Offenen Jugendwerkstatt Karlsruhe e.V. (OJW) an der Hohenwettersbacher Straße in Grünwettersbach. Carolin Gussetti-Wagner, Alea Müller und Julie Fischer, eine dreiköpfige Schülerinnengruppe des Durlacher Markgrafen-Gymnasiums entwarf und baute die Kästen mit fachkundiger Unterstützung durch das Fraunhofer Institut für Chemische Technologie (ICT) und die am ICT angesiedelte TheoPrax-Stiftung. Drei der in ihrer Bauart unterschiedlichen Kästen wurden an die Rückwand einer Werkstatthalle angebracht. Einen weiteren Kasten befestigte Uwe Benitz von der Bergwacht auf Anraten des Karlsruher NABU-Vorsitzenden Artur Bossert bei einer regennassen Kletterpartie an den Stamm eines Baumes, am Steinbruchrand.
Die Aufgabe des Projektes besteht darin, die Nisthilfen aus einem neuartigen Biopartikelschaum, der Styropor ähnlich sieht und vergleichbare Dämmwerte besitzt, aber aus Naturprodukten besteht, zu bauen, die später auch bei Fassaden öffentlicher Gebäude in diese Art Wärmedämmung integriert werden könnten, ohne Kältebrücken zu schaffen. Den Fledermäusen genügt ein schmaler Schlitz und eine frostfreie Höhle als Überwinterungsquartier, und im Sommer zur Aufzucht des Nachwuchses. In dem Projekt soll geklärt werden, ob die Tiere das Material als Wohnstatt annehmen. Hierzu werden die Schülerinnen fortlaufend Temperatur und Feuchte in den Kästen messen und den Besiedelungserfolg beobachten. Für die OJW ist dieses Projekt eine Bereicherung durch den hohen ökologischen Stellenwert.
Astronomie in der OJW
Von der OJW ins Weltall und zurück
Dank der Gas Versorgung Süddeutschland GmbH, Stuttgart, die uns für unser Projekt Astronomie einen Check von 1000 € überreichten, beschäftigt sich eine Gruppe von Jugendlichen der OJW seit Januar mit viel Interesse und Engagement auf dem Gebiet der Astronomie.
Dr. Carolin Liefke vom Haus der Astronomie Heidelberg und Dr. Dominik Elsäßer von der Universität Würzburg, ermöglichen als Fachleute uns, viel über Astronomie zu lernen und bei klarem Nachthimmel Sterne mit guten mitgebrachten Teleskopen zu sehen und zu erkennen. An einem der bereits gelaufenen Astronomietage bauten 15 Kinder eigene Linsenteleskope, die sie alle stolz nach Hause trugen und nun anwenden. Über Rechner werden Stefan Essig, Christoph Hahn und Dörthe Krause in die Bedienung des Teleskops ROTAT auf dem Gelände des Observatoire de Haut Provence in der Provence in Südfrankreich eingearbeitet, so dass von der OJW aus in Kürze dies Teleskop bedient werden kann und Schulklassen, wie natürlich auch alle OJWler selbst solch ein Teleskop bedienen und nutzen können.
Wir freuen uns über den erfolgreichen Start des Projektes und hoffen, dass die Astronomie eine Dauereinrichtung der OJW wird.
Wenn Schulen sich hierfür interessieren und mitmachen möchten, freuen wir uns, wenn sie sich bei uns melden.
Dörthe Krause, doerthe.krause(at)ict.fraunhofer.de
L2V Kick-off
Kick-off am MGG - zum ersten Mal 3 Parteien an einem Tisch
Anfang Oktober (08.10.2015) trafen sich drei Schülerteams des Markgrafen-Gymnasiums, drei Vertreter der "Offenen Jugendwerkstatt Karlsruhe" und vier Vertreter von Firmen und Industrie. Was führte die 3 Gruppen zusammen?
"LernortLabor" - Bundesverband der Schülerlabore hat bundesweit 12 Ausschreibungen für Schülerlabore bzw. Schülerwerkstätten ausgelobt. Unter dem Motto "Unternehmergeist fördern" sollen unter Federführung der Schülerwerkstatt, Schülerinnen- und Schüler-Teams Aufträge aus der Industrie oder von Firmen innerhalb eines Schuljahres bearbeiten.
Die Themenstellungen kommen im Regelfall aus den Bereichen Naturwissenschaften, Technik, Informatik und Umwelt. Das notwendige Projektmanagement erhalten die Schüler von den Schulen, dem TheoPrax-Zentrum Pfinztal und der Deutschen Kinder- und Jugend-Stiftung, alles Partner unter dem Schirm "Lab2Venture" des LernortLabors. Die "Offene Jugendwerkstatt Karlsruhe" hilft den Teams in allen handwerklichen und technischen Problembereichen mit dem Fachwissen ihrer Betreuer und den Werkstätten mit vielfältiger Ausstattung, die die allgemeinbildenden Schulen nicht anbieten können.
Konkret lernten sich an diesem Nachmittag alle Beteiligten kennen, die Auftraggeber konnten ihren Auftrag genauer erläutern und die Schüler löcherten umgekehrt mit ihren Fragen. So will ein Automobilzulieferer, der PKW-Tanks herstellt, die Roboterarbeit optimieren. Der häufige Produktwechsel zwingt zu häufigem Wechsel der Werkzeuge an einem Roboterarm. Das kostet bei dem gegenwärtigen Verfahren, teils noch mit Handbetrieb, sehr viel Zeit. Die Schüler sollen nun einen "Greifer-Werkzeug-Bahnhof" entwerfen, mit dem dieser Wechselprozess automatisch und reibungslos vonstattengehen kann. Das zweite Schülerteam wird sich mit einem thermoelektrischen Generator (TEG) befassen, mit dessen Hilfe man bei großen Temperarturdifferenzen, z.B. an der Auspuffanlage eines Autos, Strom erzeugen kann. Hier geht es speziell darum den Stand der Technik für ein Ingenieurbüro aufzuarbeiten und ein didaktisches Modul zu entwickeln, das es Jugendlichen ermöglicht weitgehend eigenständig und handlungsorientiert, sich in die Thematik TEG einzuarbeiten. Die dritte Gruppe wird für einen selbständigen Imker mit neuen Materialien einen "Home-Hive"-Bienenkasten bauen und testen. Hierbei geht es vor allem darum, ideale Bedingungen für Honigbienen zu schaffen und günstige Produktionsbedingungen auszutesten.
Die Spannung wuchs im Laufe des Nachmittags bei allen Beteiligten, nachdem jeder die volle Tragweite des Auftrages, die Schwierigkeiten der Fragestellungen und die unterschiedlichen Erwartungen kennen lernte. Alle Beteiligten sind auf die Ergebnisse der Projekte mit Ernstcharakter im Angebot-Auftrags-Verhältnis im Juli 2015 gespannt. Sicher wird hier der Unternehmergeist bei den Schülern gefordert und gefördert.
Hans Riehm
Projekt „Gemeinsam schaffen – Gescha"
Die OJW will durch gemeinsame Arbeiten (Jugendliche und Erwachsene der OJW mit Flüchtlingskindern und –Jugendlichen) ein vorurteilsfreies Kennenlernen der unterschiedlichen Teilnehmer erreichen, und gleichzeitig für alle Beteiligten durch „Gemeinsames Schaffen (Gescha)“ zu gemeinsamen Erfolgserlebnissen beitragen. Zielgruppe sind Kinder ab 10 Jahre und jugendliche Asylanten bis 17 Jahre, die zurzeit in Karlsruhe untergebracht sind, und durch eine gemeinsame Projektarbeit handwerkliche Fähigkeiten und Sozialkompetenzen erlernen und durch diese Projektarbeiten in das bestehende soziale Gefüge der Offenen Jugendwerkstatt (OJW) integriert werden. Insbesondere bei handwerklichen Tätigkeiten, kann durch „Vormachen“ die Sprachbarriere überwunden werden und Deutsch erlernt werden.
Durch das gemeinsame Arbeiten lernen sich die TeilnehmerInnen (Deutsche der OJW, wie die Flüchtlingskinder) in ihrer kulturellen Unterschiedlichkeit kennen und sie lernen diese Unterschiedlichkeiten auch achten und akzeptieren.
An 18 halben Tagen auch Samstagen während der Projektlaufzeit bis Ende 2016 sollen mit je 10 Flüchtlingskindern und deutschen Jugendlichen in der OJW gemeinsam Projektarbeiten handwerklicher Art durchgeführt werden. Hierzu gehört das Arbeiten mit Metallen und Holz, Drechseln, Schweißen, Fräsen, Schmieden, so wie auch z.B. für Mädchen die Herstellung von Schmuck, aber auch Projekte mit einem 3D-Drucker.
Das Projekt wird gefördert aus dem städtischen Flüchtlingsfond, Büro für Integration, Karlsruhe
Dörthe Kr.
Diese Webseite wurde mit Jimdo erstellt! Jetzt kostenlos registrieren auf https://de.jimdo.com